
„Wir wollten zeigen, dass die Musik überlebt hat“
Thomas und Hans, es ist zwei Jahre her, dass Ihr mit den Hosen drei besondere Konzerte in der Tonhalle gespielt habt. Es gibt viele Menschen, die sagen, die Live-Platte komme genau zur rechten Zeit ...

Campino mit Prof. Thomas Leander
Steingen: Für die Themen, die wir bei den Konzerten angesprochen haben, gibt es kein „rechtzeitig“. Im Zweifel gibt es da nur ein „zu spät“, besonders, wenn man feststellt, dass diese Themen an Aktualität gewonnen haben. Das ist schlimm und zeigt doch die beständige Notwendigkeit sich persönlich und als Gesellschaft damit auseinanderzusetzen. Wenn man z. B. die Flüchtlingssituation in der Gesellschaft früher, realistischer und mit weniger polemisierender Rhetorik, die wie geistige Brandsätze wirken, diskutiert hätte, würde die Meute wohlmöglich heute nicht so unreflektiert der Pegida-Bewegung folgen. Schlimm auch, dass offene Fremdenfeindlichkeit scheinbar salonfähig geworden ist. Auf der anderen Seite gibt es aber auch die große Hilfsbereitschaft so vieler Menschen. Das finde ich beeindruckend.
Welcher Grundgedanke steckte hinter dem Projekt?
Leander: 2013 jährten sich die „Reichsmusiktage“ zum 75. Mal. Ich war schon 1988 als Pianist bei den 50-jährigen Gedenkfeiern dabei. So war ganz klar, dass wir mit unseren Musikern der Robert Schumann Hochschule ein wichtiges Düsseldorfer-Thema auf die Bühne bringen mussten.
Was genau waren die „Reichsmusiktage“?
Leander: Das war eine Propagandaveranstaltung der Nazis in ganz Düsseldorf. Eröffnet wurden sie damals von Reichspropagandaminister Goebbels. Im Rahmen dieser Tage gab es die Ausstellung „Entartete Musik“ im Ehrenhof, um Musiker und Komponisten zu diffamieren, die jüdischer Herkunft waren. 1937 hatte es bereits die Ausstellung „Entartete Kunst“ in München gegeben, bei dem jüdische Maler und Bildhauer diffamiert wurden.
Was für Musik zählte dazu?
Leander: Werke jüdischer Komponisten, Unterhaltungsmusik und Avantgarde, wie Schönberg, wurden von den Nazis verachtet – angefangen mit Jazzmusik bis hin zu Kurt Weills Opern. Es hat den Menschen eigentlich gefallen – aber plötzlich wurde es verboten, weil es nicht der Geisteshaltung der Nationalsozialisten entsprach.
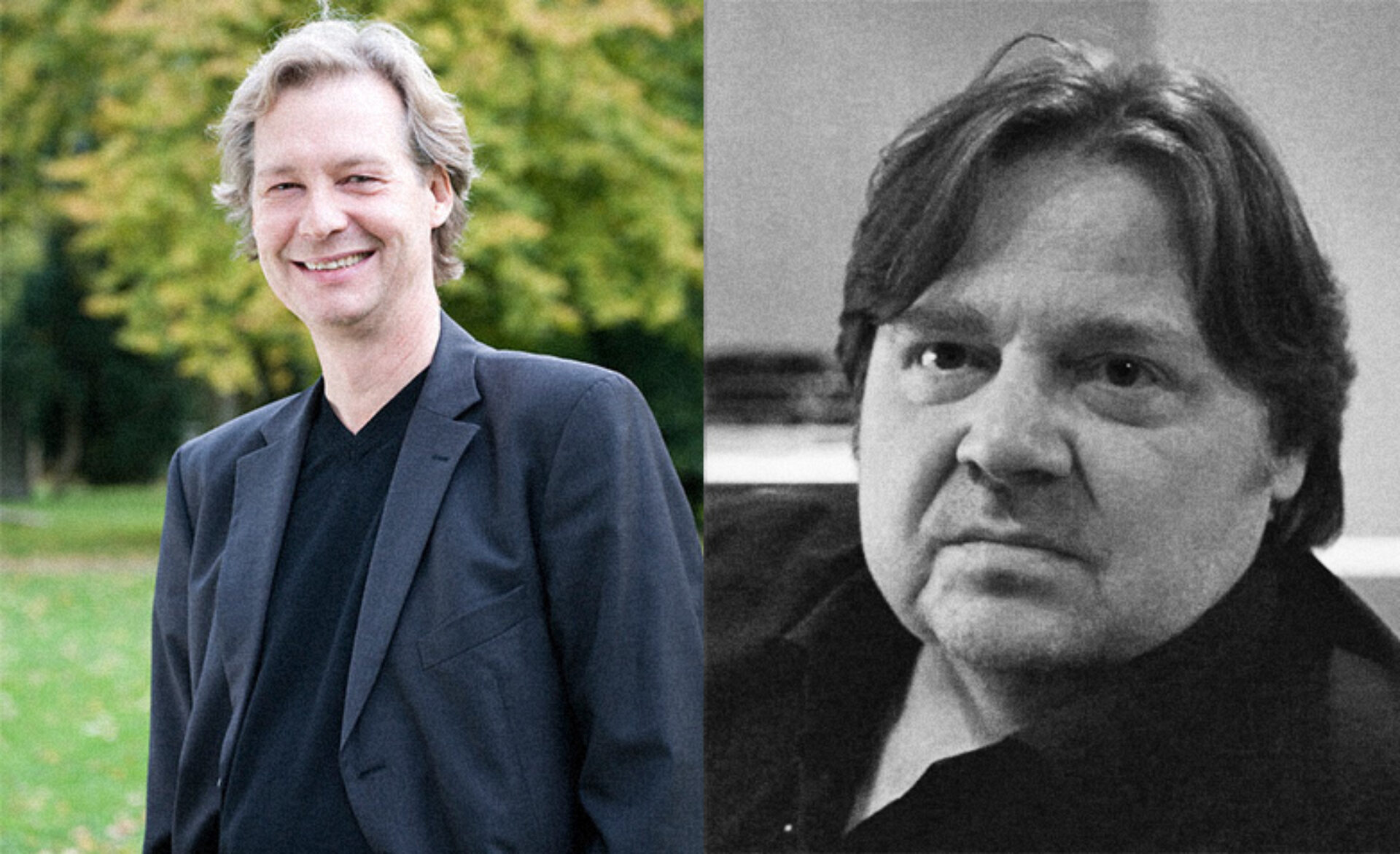
Leander & Steingen
Wie ist die Zusammenarbeit mit den Hosen entstanden?
Leander: Es war naheliegend für ein solches musikalisches Projekt in Düsseldorf, die Toten Hosen anzusprechen. Sie haben sich immer ganz klar gegen Rechts ausgesprochen. Erstmals habe ich sie im Januar 2011 angeschrieben. Eine Woche später kam eine E-Mail von Campino: „Ich möchte Sie kennenlernen.“
Und dann war gleich alles klar?
Leander: Es ging erstmal darum, ob wir miteinander harmonieren. Ich komme ja aus einer ganz anderen Etage des gleichen musikalischen Hauses, wie Campino das später treffend ausgedrückt hat. Wir trafen uns also in einem kleinen Café in Flingern. Um die Ecke war zufällig das Krankenhaus, in dem ich geboren wurde. Ich erzählte Campino davon und der sagte: „Ach, Du auch?“ So war das Eis schnell gebrochen.
Wie ist das musikalische Konzept entstanden?
Leander: Wir hatten als Basis das große Thema, welches ich mit Frau Dr. Yvonne Wasserloos entwickelt habe. Dann haben wir zu den Hosen gesagt: Wir möchten Eure Musik spielen. Und Ihr sollt „unsere“ spielen – also klassische Musik. Und Campino sollte dabei, so unser großer Wunsch, als Solist mitwirken.
Ab wann habt Ihr über die Songauswahl gesprochen?
Leander: Campino, Hans und ich haben sofort losgelegt und überlegt, welche Stücke sich eignen. Zum ersten Mal getroffen haben Hans und ich uns im Juni 2012, anderthalb Jahre vor den drei Konzerten. Und Hans hat die Stücke dann so wunderbar arrangiert, dass das überhaupt möglich wurde.
Steingen: Wir haben uns nach dem ersten Treffen nochmal zurückgezogen und haben weiter recherchiert, welche Stücke besonders gut passen. Wir wollten die Stärke der Musik zeigen und keinen Betroffenheitsabend veranstalten. Es ging nicht zuletzt auch darum, zu zeigen, dass die Musik überlebt hat.
Für welche Komponisten habt Ihr Euch entschieden?
Steingen: Schönberg ist sicher eine zentrale Figur. Von ihm gibt es z. B. die Komposition „Ein Überlebender aus Warschau“, das die dramatischen Ereignisse selbst zum Thema macht. Die Lieder der Comedian Harmonists z. B. sind da ganz anders gelagert und der Unterhaltungsmusik ihrer Zeit zuzuordnen. Sie waren, ähnlich wie die Dreigroschenoper von Brecht und Weill sehr erfolgreich, bevor sie von den Nazis verboten wurden. Ihre Musik hat aber sicher geholfen, unserem Publikum den Zugang zu vereinfachen.
Leander: Genauso habe ich das auch bei dem Stück „Einen kleinen Nazi hat sie“ empfunden. Ein ironischer Text über die Nazis von 1928.
Steingen: Es ist ein Stück, das die Hosen schon vorher für sich entdeckt hatten und das zum einen wegen des satirischen Humors und zum anderen wegen des tragischen Schicksals von Fritz Grünbaum zum Thema passte. Eine erste Version gab es bereits auf dem Studioalbum „Die Geister, die wir riefen“.
Leander: Für mich war aber auch sofort klar, dass klassische Filmmusik gut reinpassen würde. „The Sea Hawk“ aus dem Jahr 1940 musste rein. Und ich habe Campino vorgeschlagen, dass er die Songs, die er 2006 in der „Dreigroschenoper“ in Berlin gesungen hat, noch einmal rausholt.
Wie hat Campino auf Schönberg reagiert?
Leander: Er sagte: „Wow, was für eine tiefe, zu Herzen gehende und erschreckende Musik das ist.“ Dann habe ich ihn gefragt, ob er sich vorstellen kann, das zu machen. Und das war dann ein langer Prozess. Wir haben zwei Jahre lang immer wieder darüber diskutiert.
Was ist denn das Spezielle an Schönberg?
Leander: Es ist ein Melodram, also „Sprecher auf Musik“, nicht gesungen. So ähnlich wie „Peter und der Wolf“, das kennt Campino ja auch ganz gut (lacht). Es ist eine echte Herausforderung, so etwas einzustudieren. Ich war absolut überzeugt davon, dass Campino das hinkriegen würde. Er hat dann noch einmal mit Klaus Maria Brandauer gesprochen und uns dann sein Okay gegeben.
Was kann man aus den Texten rauslesen?
Steingen: Wir haben während der Recherche einige Stücke gefunden, die beweisen, dass man vor 1933 merken konnte, was mit den Nazis über Deutschland heraufzieht. Künstler und Kabarettisten haben sich schon früher damit auseinandergesetzt, was das für ein brauner Haufen ist. Es zeigt, wie wichtig Kommunikation und Aufklärung sind, um vorbeugend schlimme Sachen zu verhindern. Leider zeigt das auch, dass Kunst, Musik und Kabarett alleine nicht reicht.
Wie habt Ihr für die Aufführung geprobt – sofort in der Tonhalle Düsseldorf?
Leander: Nein, die Einzelproben fanden erstmal am Klavier in der Hochschule statt.
Steingen: Die Hosen und ich haben im Vorfeld im Band-Probenraum immer mal wieder für diese Konzerte geprobt und überlegt, wie wir die Dinge angehen wollen. Das war auch schon ziemlich intensiv, auch weil man die Themen ja nicht einfach abschalten kann, wenn man ein Stück zu Ende gespielt hat.
Leander: Zusammengebaut haben wir alles nach dem letzten Konzert der Tournee im Konzertsaal unserer Hochschule. Zwei Tage nach dem Tourfinale in der Düsseldorfer Arena ging es richtig los.
Steingen: Innerhalb von vier extrem berauschenden und disziplinierten Probentagen stand das Programm. Und für die Generalprobe sind wir dann in die Tonhalle umgezogen.
Thomas, was wusstest Du vorher über die musikalischen Fähigkeiten der Hosen?
Leander: Ich hatte mir das „Alles ohne Strom“-Konzert 2012 in der Tonhalle angeschaut, was mich ziemlich beeindruckt hat. Auch wenn ich aus der Klassik komme und das eine ganz andere Welt ist, habe ich mich in ihrer Gegenwart sofort wohlgefühlt. Man hat sofort gemerkt, dass sie am selben Strang ziehen. Es war Respekt und Verständnis für die Arbeit des anderen da.
Waren Dir die Hosen schon mal früher aufgefallen?
Leander: Als ich als junger Student 1982/83 an der Musikhochschule studiert habe, wusste ich, dass die Punk-Szene auf der nahen Ratinger Straße tobte. Aber das war noch Lichtjahre von mir entfernt. Ich war damit beschäftigt, meinen Beethoven und meinen Prokofjew zu erarbeiten. Und die saßen da herum und hauten mal richtig auf den Putz. Im Grunde war ich damals neidisch auf sie, wegen ihres unkonventionellen Umgangs mit Musik.
Campino ist ja jemand, der auch immer viel liest. Habt Ihr bemerkt, dass er sich zusätzliches Wissen angeeignet hat?
Steingen: Wenn wir uns getroffen haben, gab es manchmal gewisse Unsicherheiten, ob etwas passt. Campino hat sich solchen Problemen dann meistens mit seinem Instinkt genähert. Er entscheidet sich oft instinktiv für das Richtige. Gleichzeitig hat er sich eingearbeitet, wusste bald über alles Bescheid, um über Detailfragen mit sich selbst zu diskutieren. Er recherchiert dann, denkt nach – ich glaube, das ist ein großer Teil seines Seins.
Leander: Er hat manchmal auch noch total spät bei mir angerufen, wenn er eine Idee hatte. So kam etwas wie die Comedian Harmonists zustande. Oder er schlug vor, Musik von Sinti und Roma in das Projekt zu integrieren. Das Stück „Komm, Zigany“ haben wir auf diese Weise entdeckt. Die Songauswahl war ein ständiges Miteinander. Es sind am Ende natürlich auch viele rausgefallen.

Hans Steingen
Was muss man bei einer solchen Produktion sonst noch beachten?
Leander: Ich hatte aus den Stücken irgendwann mal eine gewisse Dramaturgie zusammengestellt. Dann hat Hans kurz drauf geschaut und gesagt: „Dir ist schon bewusst, dass zwischen diesen beiden Stücken 40 Leute von der Bühne und 60 auf die Bühne müssen?“
Steingen: Dramaturgisch wäre es super gewesen, logistisch aber war es nicht machbar. Insgesamt fand ich es aber gar nicht so schwierig den Ablauf des Programms so festzulegen, dass er dramaturgisch und logistisch funktioniert. Vieles hat sich da auch gegenseitig bedingt. Es war zum Beispiel schnell klar, dass der Schönberg am Ende der ersten Hälfte eingeordnet werden musste. Dieses Stück braucht einen exponierten Platz und etwas Zeit danach um das Gehörte zu verdauen. Da will man nicht sofort etwas Anderes hören oder spielen.
Welche Stücke bedurften einer besonderen Einordnung?
Steingen: Das Schlaflied „Wiegala“ ist auf den ersten Blick ein kleines, liebliches Liedchen. Wenn man hinterher hört, in welchem Kontext das zu sehen ist, ist es ähnlich schockierend wie der quasi Augenzeugenbericht des Überlebenden aus Warschau von Schönberg. Die Komponistin Ilse Weber soll es beim Gang in die Gaskammer für ihren Sohn und die anderen Kinder gesungen haben. Wir haben „Wiegala“ auch deshalb dem Schönberg vorangestellt, weil wir uns gesagt haben: Wenn der Platz da ist, um das Publikum richtig zu schocken, sollten wir das auch tun.
Leander: Eisler haben wir mit „Brundibár“ verknüpft, einer Kinderoper, die erstmal etwas scheinbar Harmloses darstellt. Die Oper wurde im KZ Theresienstadt von Kindern gespielt. Die Proben ließen den schrecklichen Alltag, der sie umgeben hat, für kurze Zeit vergessen. Es ging darum, aus dem Alltag herauszutreten, mal wieder ein bisschen Kind sein zu dürfen. Etwas zu tun, was sie von ihren schrecklichen Gedanken wegbringt. Einerseits ist es eine total positive Musik. Wenn man dann aber erfährt, dass nur zwei Kinder aus dem Chor den Krieg überlebt haben, wird einem ganz anders.
Steingen: Das war die schlimme Information, die man beim Konzert mitgeliefert bekommen hat. Das Schlimmste steht für mich aber immer noch zwischen den Zeilen: der Missbrauch der Musik für die Propaganda der Nazis. Für einen Film verwendeten sie einen Ausschnitt aus der Oper, um der zweifelnden Bevölkerung vorzutäuschen, wie normal die Deportierten lebten.
Die Komponistin Ilse Weber soll es beim Gang in die Gaskammer für ihren Sohn und die anderen Kinder gesungen haben. Wir haben „Wiegala“ auch deshalb dem Schönberg vorangestellt, weil wir uns gesagt haben: Wenn der Platz da ist, um das Publikum richtig zu schocken, sollten wir das auch tun.
Steingen
Leander: Eisler haben wir mit „Brundibár“ verknüpft, einer Kinderoper, die erstmal etwas scheinbar Harmloses darstellt. Die Oper wurde im KZ Theresienstadt von Kindern gespielt. Die Proben ließen den schrecklichen Alltag, der sie umgeben hat, für kurze Zeit vergessen. Es ging darum, aus dem Alltag herauszutreten, mal wieder ein bisschen Kind sein zu dürfen. Etwas zu tun, was sie von ihren schrecklichen Gedanken wegbringt. Einerseits ist es eine total positive Musik. Wenn man dann aber erfährt, dass nur zwei Kinder aus dem Chor den Krieg überlebt haben, wird einem ganz anders.
Steingen: Das war die schlimme Information, die man beim Konzert mitgeliefert bekommen hat. Das Schlimmste steht für mich aber immer noch zwischen den Zeilen: der Missbrauch der Musik für die Propaganda der Nazis. Für einen Film verwendeten sie einen Ausschnitt aus der Oper, um der zweifelnden Bevölkerung vorzutäuschen, wie normal die Deportierten lebten.
Thomas, Du hast im Wechsel mit Campino durchs Programm geführt. Warum brauchte das Konzert Eure Erläuterungen?
Leander: Campino und mir war recht schnell klar, dass es zweier Moderationen bedurfte. Wir haben uns ganz genau überlegt, was wir da machen, wann wir etwas sagen.
Steingen: Wir haben dabei auch aus dem ersten Abend gelernt. Man erkennt oft erst bei der Premiere, was noch nicht rund ist und stellt dann doch noch etwas um. Wir haben das Programm nicht umgestellt, aber kapiert, dass der Abend schneller funktionieren muss. Wir haben es z. B. geschafft, dass das Auf- und Abtreten reibungsloser und weniger auffällig passieren konnte. Das hatten wir ja nie richtig geprobt.
Leander: Wir sind am ersten Abend auf die Bühne gegangen und wussten nicht, wie lange das Konzert gehen würde.
Steingen: Die Generalprobe hat sieben Stunden gedauert!
Leander: Ich glaube, das war sogar noch länger. Wir haben morgens um zehn Uhr angefangen, und das ging dann bis 22 Uhr. Letztlich haben wir beim ersten Konzert um zehn nach acht angefangen und waren um halb elf fertig. Es war ja auch noch eine Pause dazwischen.
Steingen: Die Moderationen haben sich nach dem ersten Abend noch einmal verändert, es ist eine andere Sicherheit entstanden, was an Information für das Publikum wichtig ist und was nicht. Ob man das Hintergrundwissen vor oder nach dem Stück liefert. Und mit welchem Gestus man es vorträgt.

Hans, für Dich war es nicht die erste Zusammenarbeit mit den Hosen. Wann habt Ihr Euch kennengelernt?
Steingen: Wir sind uns in dem Studio über den Weg gelaufen, in dem einst die „Damenwahl“-LP aufgenommen wurde, die ehemalige Klangwerkstatt. Dort hatte ich mein erstes Studio eingerichtet. Damals befand ich mich noch in der Ausbildung als klassischer Musiker. Mein Herz pendelt immer zwischen den verschiedenen Musikstilen hin und her. Die erste gemeinsame Produktion war dann „Hip Hop Bommi Bop“, zusammen mit Jon Caffery.
Was waren Eure weiteren Projekte?
Steingen: Ich habe dann für die Hosen öfter mal Keyboard oder Klavier gespielt oder Orchester arrangiert. Woran ich mich natürlich sofort erinnere, ist, dass wir mal mitten im Hochsommer ein Weihnachtsalbum aufgenommen haben. Und ob das die langen Tage während „Auf dem Kreuzzug ins Glück“ in den LaChapelle-Studios in Belgien sind, oder die intensive Arbeit für das Unplugged-Album... die Erinnerungen sind so vielfältig, dass diese eher den Rahmen hier sprengen würde. „In aller Stille“ z. B. zog sich über anderthalb Jahre, unterlief viele Entwicklungen und ist ein Album, mit dem ich mich besonders identifiziere. Das war auch das erste Mal, dass wir mit Vincent Sorg zusammengearbeitet haben.
Was unterscheidet die Hosen von anderen Musikern, mit denen Du arbeitest?
Steingen: Ich konnte mich immer für die Themen begeistern, mit denen sich die Hosen beschäftigt haben. Oft habe ich festgestellt, dass ich mich mit Ähnlichem beschäftige, auch wenn ich das in meinen anderen Arbeiten ganz anders ausdrücke. Ich schreibe ja im wesentlichen Musik, was eher eine abstrakte Form des Ausdrucks ist. Müsste ich Texte schreiben, würde ich mich doch sehr viel schwerer tun. Wenn jemand aber so virtuos mit Texten umgeht wie Campino, der die Sprache als Kunstform und Instrument begreift, habe ich großen Respekt davor. Die Suche und das Finden der richtigen Musik, das sich musikalisch Weiterentwickeln und sich dabei seiner Wurzeln treu zu sein, immer noch heimlich so zu tun, als wären alle Lieder einfache drei Akkorde Stücke oder auch, dass es nicht ein Gitarren-Solo bei den Hosen gibt, in dem Kuddel raushängen lässt, was für ein toller Gitarrist er ist - es geht ihm immer um die Melodie und nicht um die olympische Disziplin höher, schneller, weiter -, das ist einiges von dem, was mich immer an den Hosen gereizt hat. Vor allem aber, dass sie es schaffen mit der Musik und ihrer Haltung die Menschen zu bewegen und ins Herz zu treffen und manchmal auch da wo’s weht tut.
Was hat sich verändert in Eurer Zusammenarbeit?
Steingen: Die Arbeit ist über die Jahre intensiver geworden. Irgendwann haben wir uns schon im Vorfeld der Platte getroffen und im Proberaum über Stücke diskutiert. Für die Unplugged-Konzerte 2005 im Burgtheater in Wien haben wir wochenlang geprobt. Jeder hat seine Spielwiese, um sein Talent wirkungsvoll auszubreiten. Ich kenne kaum eine Gruppe von Menschen, wo das so gut umgesetzt ist, wie bei den Hosen.
Wie genau läuft das in der Praxis ab?
Steingen: Wenn es darum geht, neue Musik zu erarbeiten, dann zählt in dem Moment nichts anderes. Für die Kreativität gibt es so eine Art „geschützten Raum“. Wenn man sich dort trifft und erstmal alles möglich ist, entstehen oft die besten Ideen. Genauso wichtig ist auch das gegenseitige Verständnis für die Musik. Wenn Campino oder Kuddel mir etwas vorstellen, finde ich immer einen Punkt, um einzuhaken. Weil ich ihre Gedanken verstehe.

Breiti hat vor dem Konzert in der Tonhalle nochmal betont, dass keiner in der Band Noten lesen kann. Ein Hindernis?
Steingen: Noten lesen zu können, ist nicht unbedingt ein Privileg. Ich freue mich, dass ich in eine Partitur gucken kann und dass die dann für mich klingt. Das ist für mich, wie ein Buch zu lesen. Es geht aber darum, etwas ins Buch zu schreiben. Dazu gehören andere Fähigkeiten. Und die besitzen die Hosen. Man muss nicht Tonika und Subdominante kennen. Ohne solch theoretisches Wissen kommt man vielleicht zu ganz anderen Ideen.
Wie ordnest Du das Live-Album aus der Tonhalle ein, wenn Du es mit früheren Produktionen vergleichst?
Steingen: „Willkommen in Deutschland“ ist – ganz klar – der bisherige Höhepunkt unserer Zusammenarbeit, in inhaltlicher und anspruchsvoller Hinsicht. Eine angreifende Musikarbeit. Wir hatten einen Anspruch, den wir einlösen wollten. Dazu gehörte auch, die Menschen zu erreichen – und das hat unfassbar gut funktioniert. Wir haben das natürlich gehofft, aber dass es dann live tatsächlich so eine Wirkung erzeugte, war für uns sehr berührend. Deswegen freue ich mich besonders darüber, dass wir das Konzert jetzt mit den CDs und einer Dokumentation auf DVD auch für viele, die damals nicht dabei sein konnten, hörbar machen können.
Thomas, eine Gemeinsamkeit zwischen Dir und den Hosen: Ihr lebt schon immer in Düsseldorf, und auch Du warst weltweit als Musiker im Einsatz. Was genau machst Du beruflich?
Leander: Mein Vater war Sänger an der Düsseldorfer Oper, bei uns stand immer ein Klavier herum. So bin ich klassischer Pianist geworden, ausgebildet an den Hochschulen in Düsseldorf, Wien und London, reiste für Konzerte viel in der Welt herum. Ich habe aber auch immer sehr gerne junge Musiker unterrichtet. Als ich vor ein paar Jahren Vater geworden bin, habe ich meine aktive Musikerkarriere beendet und bekam das Angebot, künstlerische Projekte an der Robert-Schumann-Hochschule zu verantworten.
Was macht Ihr dort genau?
Leander: Wir organisieren klassische Musik zu Ausstellungen oder eben so ein Projekt wie mit den Hosen. Es geht immer darum, dass man Studierenden bereits während des Studiums die Möglichkeit bietet, so etwas auszuprobieren. Auch unser Institut für Musik und Medien war an den Konzerten beteiligt. Die drei Konzerte sind in Ton und Bild von unseren Studierenden aufgezeichnet worden, in Begleitung der Professoren. Insgesamt waren von unserer Hochschule 215 Menschen an dem Projekt beteiligt. Das ist ein Viertel der Studierenden.
Der Gewinn aus dem Verkauf der Doppel-CD geht dann auch an die Hochschule...
Leander: Da muss ich mich jetzt echt mal bei den Hosen bedanken. Sie waren insgesamt sehr großzügig, alleine hätten wir das nicht bewältigen können. Für sie war von Anfang an klar, dass der Erlös für Stipendien und künstlerische Projekte genutzt werden sollte. Und das ist genau das, was man als Hochschule leisten muss, damit klassische Musiker heutzutage eine Berufschance haben.




